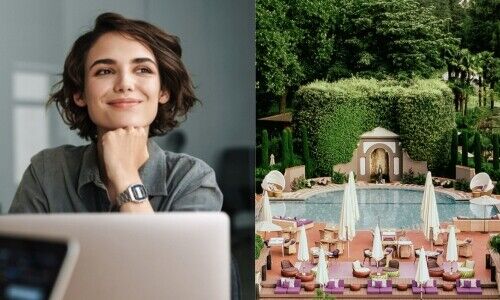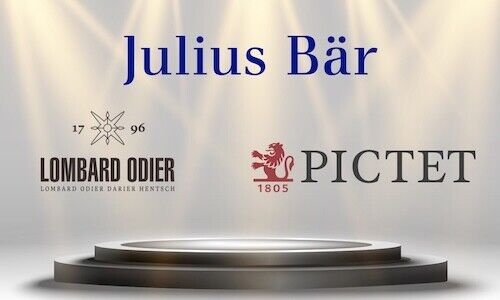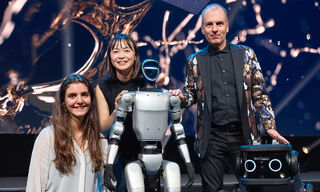BIL Suisse: Im Spannungsfeld von KI und Energiegewinnung
Im Ambiente der Cantina Moncucchetto bei Lugano fand unlängst eine von der Banque Internationale de Luxembourg, BIL Suisse, organisierte Veranstaltung über die wachsende Rolle der Künstlichen Intelligenz im Energiemarkt statt. Entscheidend für die weitere Entwicklung ist die eigentliche Stromerzeugung.
Von Giorgio Armandola, Redaktor, finewsticino.ch
Vergleicht man die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) mit jener der menschlichen Intelligenz, so entsprach das kognitive Niveau der KI im Jahr 2019 dem eines Vorschulkindes.
Bereits 2021 hatte die KI das Niveau einer Grundschulausbildung übertroffen, um 2023/2024 das Wissen eines sehr guten Gymnasiasten zu erreichen. Und in Zukunft? Mit dieser Frage und auch anderen befasste sich vergangene Woche eine Veranstaltung der Bank BIL Suisse in Lugano. Der Anlass fand im Nachgang zur Konferenz «Decentralized Finance» statt.
Unvorstellbare Grössenordnung
Prognosen zufolge könnte die KI bereits 2027 das Wissensniveau eines Universitätsforschers erreichen. Vor diesem Hintergrund eröffnen sich Invesititonsmöglichkeiten in einer bisher kaum dagewesenen Grössenordnung, was wiederum die KI‐Branche zu einem Geschäftsfeld mit einem enormen Kapitalbedarf macht.
Cantina Moncucchetto (Bild: Facebook)
Zu diesem Thema sprachen in der Cantina Moncucchetto bei Lugano vor einem ausgewählten Kreis von unternehmensnahen Bankkunden Ed Hesse, Gründer und Präsident von Energy Web, sowie Trent Mc Conaghy, Mitgründer von Ocean Protocol und ASI. Die Diskussion wurde von Sascha Wullschleger moderiert, seines Zeichens Head of Wealth Management Lugano bei der BIL Suisse.
Gigantische Rechenzentren
Wie zu erfahren war, liegen die grössten Herausforderungen im Umgang mit der KI zu Beginn des Prozesses, wenn beispiellose Rechenleistungen benötigt werden, die ihrerseits Energiemengen erfordern, die vor dem Zeitalter der KI kaum vorstellbar waren.
Die von Mc Conaghy zitierten Zahlen sind eindrucksvoll: Die Investitionsausgaben der drei grössten Akteure – Meta, Google und Microsoft – lagen 2024 bei mehr als 150 Milliarden Dollar, verglichen mit 87 Milliarden im Jahr 2023 und 28 Milliarden 2017. Der Löwenanteil fliesst dabei in den Bau von Rechenzentren, die höchst energieintensiv sind und grosse Kapitalinvestitionen erfordern.
Beispiel Nvidia
Parallel dazu wächst die wirtschaftliche Bedeutung der KI rasant: Nvidia, ein weltweit führender Anbieter von KI‐Computing, steigerte seinen Umsatz von weniger als fünf Milliarden Dollar in den Jahren 2022/23 auf mehr als 20 Milliarden Dollar im Jahr 2024.
BIL-Suisse-Lunch in der Cantina Moncucchetto bei Lugano (Bild: SW)
Und auf der Energieseite? Ebenso konsequent steigt der von der KI verursachte Energiebedarf exponenziell an. Entsprach der von KI verbrauchte Strom 2022 noch dem durchschnittlichen Verbrauch von 10'000 Haushalten, so wird für 2026 bereits ein Bedarf erwartet, der der Produktion eines Kernkraftwerks entspricht; bis 2030 könnte die Nachfrage etwa 20 Prozent der gesamten Stromerzeugung der USA erreichen.
Enorme Produktion in China
Manche Prognosen sehen den KI‐Stromverbrauch sogar von anfänglich drei Prozent auf 99 Prozent der in den USA produzierten Energie steigen. Ein interessanter Aspekt betrifft dabei die internationalen Relationen.
Der Vergleich der Stromproduktion der grössten westlichen Länder und China fällt ernüchternd aus. Während Europa sowie die USA 2023 bei rund 4'000 bis 5'000 Terawattstunden (TWh) lagen, übertraf China damals bereits deutlich die Marke von 8'000 TWh. Nicht zu vergessen ist Indien, dessen Produktion langsam, aber stetig auf etwa 2'000 TWh angewachsen ist.
Ungleichmässig verteilt
Aus diesen Entwicklungen lässt sich ableiten: Die weltweite Energieproduktion steigt, wenn auch ungleichmässig verteilt, während die Nachfrage noch schneller wächst – konzentriert in klar definierten Sektoren wie Computing und KI. Werden also in Zukunft die grossen Rechenzentren die Energiepreise diktieren?