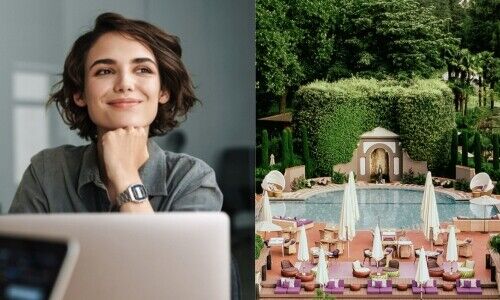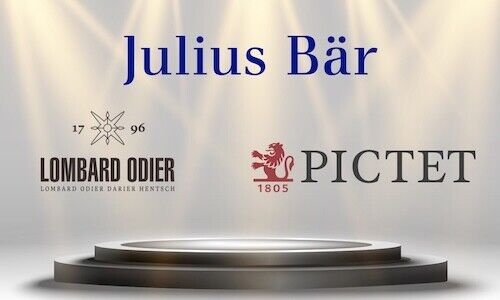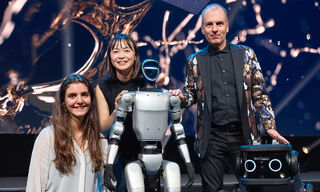Florence Pisani: «Ganz sicher nicht so, wie es Donald Trump anpackt»
Die Diagnose des US-Präsidenten, dass die globalen Ungleichgewichte im Handel und im Kapitalverkehr nicht nachhaltig sind, ist richtig. Aber mit seiner Politik trägt er nicht zum Ausgleich bei, im Gegenteil. Florence Pisani, Chefökonomin von Candriam, erklärt warum. Und sie sagt auch, wo sie mit ihren Prognosen für 2025 danebengelegen hat.
Normalerweise ist es eher Routine: Ökonomen überprüfen im Juni die Prognosen und Einschätzungen, die sie im Dezember für das kommende Jahr abgegeben haben und nehmen entsprechende Adjustierungen vor. 2025 ist anders, v.a. wegen Donald Trumps schwer berechenbaren Politikstils. Entsprechend ist auch der Informationsbedarf der Anleger viel grösser.
finews.ch unterhielt sich in Zürich mit der Chefökonomin des Vermögensverwalters Candriam, Florence Pisani, über das von Trump heissgeliebte Instrument der Zölle, globale Ungleichgewichte, das Comeback der Industriepolitik in Europa und das Vorbild China.
Frau Pisani, hat sich Donald Trump an das Drehbuch gehalten, das Sie Ende Jahr entworfen hatten?
Der US-Präsident tat, war er vor der Wahl versprochen hat, in der Zollpolitik und in der Migration. Und mit dem «One, Big, Beautiful Bill Act» (OBBBA), den er nun durch den Kongress bringen will, wird er auch sein Wahlversprechen einlösen, die Steuern weiter zu senken – «no tax on tips, no tax on overtime». Allerdings war damals unser Hauptszenario, dass die Zölle nur «soft» und damit moderat erhöht werden. Am «Liberation Day» schien sich dagegen unser Alternativszenario eines «Hard-Trumps» zu materalisieren. Nach dem Hin und Her der letzten Monate liegen wir aktuell irgendwo dazwischen.
Der Präsident scheint Zölle zu lieben, ebenso sehr, wie Ökonomen sie hassen.
Für ihn sind sie eine Allzweckwaffe, mit der er mehrere Ziel zugleich treffen will: Die Unternehmen sollen wieder in den USA Fabriken bauen, statt Güter zu einzuführen, das Land soll reindustrialisiert werden, und die Einnahmen sollen die aufgrund des OBBBA zu erwartenden Steuerausfälle kompensieren.
«Zölle sind für Trump eine Allzweckwaffe, mit der er mehrere Ziele zugleich treffen will.»
Sind Zölle wirklich so schlimm? Immerhin handelt es sich um ein transparentes und damit auch relativ gut verhandelbares Instrument – anders als die sogenannten nichttarifären Handelshemmnisse, wie Subventionen, Standards und Normen, Kontingente usw.
Trump hat einen Punkt, wenn er nicht nur die Zölle, sondern auch die anderen Massnahmen einbezieht. Aber pauschale Zölle auf sämtliche Einfuhren ergeben keinen Sinn, weil kein Land alles selber machen will. Selektive Zölle wie in der ersten Amtszeit Trumps oder wie aktuell diejenigen der EU auf Elektroautos können dagegen sinnvoll sein – man muss ja nicht warten, bis die ganze eigene Industrie kaputtgegangen ist.
Was hat Sie in den letzten sechs Monaten in Bezug auf die USA am meisten überrascht?
Dass das Vertrauen in den Dollar derart erschüttert wird, haben wir nicht erwartet. Und auch das Vertrauen, dass die USA die militärische Sicherheit Europas garantieren werden, ist geschwunden.
Internationale Organisationen warnen seit Jahrzehnten vor globalen Ungleichgewichten in der Wirtschaft, im Handel und Kapitalverkehr. Sie selbst haben nach der Finanzkrise mit Ihrem damaligen Berufskollegen Anton Brender ein Buch darüber verfasst. Hat Trump mit seiner Diagnose recht, dass die heutige Situation nicht nachhaltig ist und sich etwas ändern muss?
Ja, auch hier hat Trump einen Punkt. Die USA sollten weniger und China mehr konsumieren. Und Europa muss mehr investieren, in Infrastruktur und Verteidigung, was sich jetzt ja abzeichnet.
Wie kann der Ausgleich gelingen?
Ganz sicher nicht so, wie es Trump anpackt: mit Ankündigungen und grossem Hin und Her viel Unsicherheit schaffen, Zölle massiv anheben und Steuern senken. Unsicherheit motiviert Unternehmen überhaupt nicht, in den USA zu investieren. Zölle allein genügen mitnichten, um die USA zu reindustrialisieren; dafür braucht es auch durch Berufsbildung qualifizierte Arbeitnehmer, Investitionen in die Infrastruktur, Forschung und Entwicklung etc. Und die Steuersenkungen des OBBBA werden im besten Fall das ohnehin schon gewaltige Staatsdefizit und damit auch die externen Ungleichgewichte nicht nochmals anschwellen lassen.
Hat nicht der Ökonom Arthur Laffer mit seiner berühmten Kurve gezeigt, dass sich Steuersenkungen über den ausgelösten Wachstumsimpuls selber finanzieren?
Leider hat die Laffer-Kurve in der Realität nie richtig funktioniert, weder bei Roland Reagan noch in Trumps erster Amtszeit. Die in der OBBBA unterstellten Wirtschaftswachstumsraten sind ausserdem viel zu hoch.
«Leider hat die Laffer-Kurve in der Realität nie richtig funktioniert.»
Sie haben die hohen Defizite der USA erwähnt – aber das eigentliche Problem ist doch die Verschuldung selber, die nach Bill Clintons Amtszeit ausser Kontrolle geriet. Bisher lautete der Konsens der Ökonomen: Die Verschuldung ist ein langfristiges Problem, aber wir können das auf absehbare Zeit aussitzen – «kick the can down the road». Gilt das immer noch?
Nein, auch diese Gewissheit ist erschüttert worden. Auf dem Papier wäre es ganz einfach: Die USA haben ein tiefes Steuerniveau und könnten z.B. die Abgaben für Superreiche erhöhen. Aber weder die Demokraten noch die Republikaner haben den Willen zur Haushaltskonsolidierung. Der OBBBA wird die Lage wie gesagt noch verschlimmern, weil im Gegenzug zu den grossen Steuersenkungen kaum irgendwo gespart wird, ausser bei Medicaid und anderen dringend benötigten Sozialprogrammen wie Kinderernährung.
- Seite 1 von 2
- Weiter >>