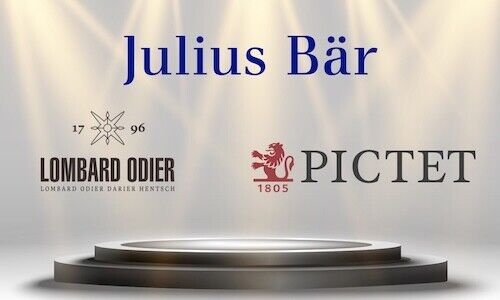Philipp Schwander: «Ein Glas Wein zum Mittagessen ist gesund»
Seit einiger Zeit findet eine intensive Debatte über den Alkoholkonsum statt. Weinhändler Philipp Schwander ist der erste Schweizer «Master of Wine» – und ein dezidierter Verteidiger des massvollen Weingenusses.
Beim bekannten St. Galler Medizinprofessor Joseph Osterwalder hat Schwander jüngst eine Untersuchung über die jüngsten Studien in Auftrag gegeben, welche die Schädlichkeit von Alkoholkonsum, angeblich ab dem ersten Tropfen, belegen wollen.
Herr Schwander, als Sie 1996 den Titel «Master of Wine» erlangten, lag der jährliche Weinkonsum in der Schweiz bei über 290 Millionen Litern. Heute sind es noch rund 218 Millionen – Tendenz zuletzt stark sinkend. Was passiert da?
Immer mehr junge Leute konsumieren sehr wenig Alkohol. Ihr Lebensstil hat sich gewissermassen «amerikanisiert». Die Gemeinschaft bei einem guten Essen und schönen Glas Wein zu geniessen ist immer weniger gefragt. Die Leute sind zudem extrem (zu extrem?) gesundheitsbewusst geworden. Das wäre grundsätzlich erfreulich. Aber mittlerweile herrscht eine regelrechte Panik vor Alkohol – geschürt durch Institutionen wie die WHO. Paradoxerweise werden die Effekte von anderen Drogen im Gegenzug immer mehr verharmlost. Es scheint, dass der moderne Zeitgeist oft alles Traditionelle aus Prinzip verdammenswert findet.
Panik? Wegen eines Glases Wein?
Genau das ist das Problem. Es heisst plötzlich: Jeder Tropfen sei schädlich. Das ist wissenschaftlich nicht haltbar. Es ist eine drastische, ideologisch geprägte Position. Freunde von mir sind von verwirrten Hausärzten sogar gewarnt worden, nicht mehr als zwei Gläser Wein – halten Sie sich fest – im Jahr (!) zu trinken.

Besuch in der Toskana: Mit Stefano und Giovanni Frascolla von Tua Rita. (Bild: zVg)
Wie kommen die Studien denn zum neuen Dogma, dass Alkohol in jeder Dosis schädlich sei?
In seiner Arbeit hat Professor Osterwalder die bekanntesten neuen Studien sorgfältig analysiert, darunter die grosse Meta-Untersuchung, die 2018 in der Fachzeitschrift «Lancet» publiziert wurde. Sie wird von den Alkoholgegnern immer wieder gerne als Argument für das Narrativ «nur kein Alkohol ist kein Risiko» zitiert, obwohl drei Jahre später in einer Follow-up-Analyse das Gegenteil herauskam, nämlich eine Schutzwirkung bei mässigem Alkoholkonsum, insbesondere für ältere Personen.
«2024 ist ein problematisches Jahr für Rotweine im Bordeaux-Gebiet.»
Stossend ist auch, dass in einer weiteren Lancet-Studie von 2020 suggeriert wird, sie sei wissenschaftlich unantastbar. Neben anderen Unstimmigkeiten wurden beispielsweise über 500 Quellen und Studien aus unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen in diese Untersuchung integriert und «zusammengerechnet». Damit wird zahlreichen Störfaktoren, welche die Ergebnisse verzerren können, Tür und Tor geöffnet. Ein Hauptgrund für den Meinungsumschwung ist der sogenannte «Abstinenz-Bias»: In vielen älteren Studien wurden ehemalige Trinker – also Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen keinen Alkohol mehr trinken – mit lebenslangen Abstinenten vermischt. Das verzerrt natürlich die Resultate. Die Abstinenten-Gruppe erscheint kränker, als sie eigentlich ist.
Was ist daran falsch, historische Verzerrungen zu korrigieren?
Es ist falsch, nur diese eine Verzerrung zu korrigieren und gleichzeitig andere, in die gegenteilige Richtung weisende und damit natürlich ebenso gravierende zu ignorieren – zum Beispiel das sogenannte «Underreporting». Man weiss, dass die Probanden in Umfragen systematisch zu niedrige Trinkmengen angeben – teilweise 75 Prozent zu wenig. Das heisst: Wer gemäss Fragebogen angeblich ‹ein Glas pro Tag› trinkt, konsumiert in Wahrheit vielleicht sogar eine Flasche. Wenn man das nicht sauber korrigiert, wirken schon angeblich kleine Mengen statistisch übermässig riskant. Genau das aber haben die meisten aktuellen Studien nicht (!) korrigiert.
Das klingt nach ziemlich wackeliger Wissenschaft.
Frei nach dem Motto: Traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Wenn man die vermeintlich wissenschaftlichen Untersuchungen ganz genau studiert, merkt man, dass sie oft sehr abenteuerlich aufgebaut sind. Wir haben das in unserem Papier deutlich dargelegt. Bei den neuen Studien werden zum Beispiel Bevölkerungsgruppen aus Entwicklungsländern mit überalterten, westlichen Gesellschaften vermischt.
Was ist daran problematisch?
In einem Drittweltland mit beispielsweise einem Durchschnittsalter von 18 Jahren gibt es wenig Herzinfarkte. Kombiniert man dortige Daten mit solchen aus überalterten Ländern wie Italien oder der Schweiz, nivelliert sich der positive Effekt des moderaten Weingenusses auf Herz und Kreislauf. Besonders fragwürdig ist diesbezüglich die in diesem Jahr erschienene Studie ‹Alcohol Intake and Health Study 2025›, vom amerikanischen Interagency Coordinating Committee on the Prevention of Underage Drinking (ICCPUD). Hier werden Daten aus anderen Ländern (!) auf amerikanische Verhältnisse hochgerechnet. Wie und warum ist nicht ersichtlich. Das eröffnet willkürlichen Anpassungen geradezu Tür und Tor. Die intransparenten, mathematischen Modelle sind schlicht nicht nachvollziehbar. Wenn das Wissenschaft sein soll, dann ist auch Lesen im Kaffeesatz wissenschaftlich.
«In Zürich sieht man kaum noch jemanden, der mittags ein Glas Wein bestellt.»
Sie bleiben also dabei: Alkohol in Massen ist bekömmlich?
Ja – zumindest für gesunde Menschen. Wer keine relevanten Vorerkrankungen hat und vernünftig konsumiert, muss sich keine Sorgen machen. Im Gegenteil: Zahlreiche Studien zeigen protektive Effekte auf das Herz-Kreislauf-System. Ein gesunder Mann ohne anderweitige Belastungen kann problemlos zwei Deziliter Wein, eine gesunde Frau ein Deziliter Wein pro Tag geniessen, bei vielen dürfte es sogar mehr sein.
Also keine Angst vor dem Glas Wein zum Mittagessen?
Nein. Es ist traurig, wie stark sich dieses Bild verändert hat. In Zürich sieht man kaum noch jemanden, der mittags ein Glas Wein bestellt. Ob ein Gurken-Smoothie soviel mehr bringt, wage ich zu bezweifeln. Darf ich folgende, leicht provokative Frage stellen: Gibt es nicht auch ein Leben vor dem Tod?

Ein Herz für Riesling: Schwander (r) mit dem Produzenten Gunter Künstler. (Bild: zVg)
Ja, auch beim Business-Lunch in der Finanzindustrie sieht man immer seltener ein Glas Wein.
Wenn man zur Kenntnis nimmt, was gewisse Banker veranstaltet haben, wünscht man sich, sie hätten mehr Wein getrunken. Ich behaupte mal, die Ergebnisse wären erfreulicher gewesen (lacht). Es ist schade, dass manche Leute den Wein vermehrt nur noch als Lifestyle-Produkt wahrnehmen: Sie trinken am Wochenende eine Flasche Masseto und posten das gross auf Social Media. Ansonsten trinken sie überhaupt keinen Alkohol mehr, respektive keinen Wein. So entsteht keine Weinkultur. Und auch kein Wissen um die Weinqualität. Es wird an einem berühmten Wein genippt, den man nur bestellt, um ein bisschen angeben zu können.
«Ein gesunder Mann ohne anderweitige Belastungen kann problemlos zwei Deziliter Wein, eine gesunde Frau ein Deziliter Wein pro Tag geniessen.»
Zum Abschluss: Derzeit läuft die Subskription des Bordeaux-Jahrgangs 2024…
Ein problematisches Jahr für Rotweine im Bordeaux-Gebiet. Es hat während der Lese fast ununterbrochen geregnet – so stark wie seit 30 Jahren nicht mehr. Ich war zweimal im Herbst vor Ort. Nasses Traubengut, schwierige Bedingungen. Ich empfehle: Finger weg von der Subskription. Solche Jahrgänge bekommt man später meist nochmals deutlich günstiger. Schauen Sie doch diesbezüglich einmal die Preisentwicklung des Bordeaux-Jahrgangs 2013 an.
Es mag aber doch sehr gute Weine darunter geben.
Absolut. Das eine oder andere Château wird ohne Zweifel überraschend schöne Weine präsentieren. Aber diesen Wein kann man auch in zwei oder drei Jahren kaufen, wenn er regulär auf den Markt kommt. Und wahrscheinlich zu einem tieferen Preis als jetzt in der Subskription.
Was begeistert Sie aktuell im eigenen Sortiment?
Wir haben zur Zeit ein wunderbares Angebot an deutschen Rieslingen. Ich finde, sie gehören zu den besten Weissweinen der Welt. Diese Weine machen mich glücklich. Ich gestehe es: In Sachen Riesling entwickle ich einen geradezu missionarischen Eifer. Erfreulicherweise entdecken mehr und mehr Schweizer die hohe Qualität dieser Weine. Aber es braucht weitere Überzeugungsarbeit, um den Leuten zu zeigen, wie herrlich belebend und erfrischend diese Weine sein können – gerade auch im Hinblick auf den Sommer.
Philipp Schwander bestand im Jahr 1996 als erster Schweizer die strenge Ausbildung zum Master of Wine. Seine Leidenschaft für den Wein pflegt er seit dem 16. Lebensjahr. Vor der Gründung seiner eigenen «Selection Schwander» im Jahr 2003 war er unter Anderem Verkaufsleiter bei «Martel» und leitete die Weinhandlung «Albert Reichmuth» in Zürich. Schwander besitzt am Bodensee das Barock-Schlösslein Freudental.